von Mazlum Nergiz
Im Dezember 1986 erfuhr der britische Künstler Derek Jarman, dass er HIV positiv war. Acht Jahre später starb Derek Jarman, 52 Jahre alt, an einer durch AIDS verursachten Krankheit in London.
Unmittelbar nach seiner Diagnose hatte er sich ein Stück Land gekauft, direkt am Meer in der südöstlich gelegenen Grafschaft Kent. Dort errichtete und kultivierte er einen Garten. Sein Garten kannte keine Grenzen, keine Schutzwälle; alles in unmittelbarer Nähe wurde Teil dieses offenen Geländes, selbst dem benachbarten Atomkraftwerk rückte Jarmans Garten auf die Pelle, er wucherte ins Meer. Jarmans Garten grenzte nicht ab, sondern potenzierte gerade die Idee, die in allen Gärten enthalten ist: die heilige Stätte, die uns Menschen vor der Raserei und dem Tumult der Welt, die uns umgibt, abschirmt. Jarman veränderte die Landschaft, in die er sich zurückgezogen hatte, mit Materialien, die er in genau dieser Landschaft vorfand – Treibholz, Steine, Relikte vergangener Kriege wie zum Beispiel Patronenhülsen – und ließ alles auf Pflanzen, Bäume und Blumen treffen. Unzählige Lebewesen bewohnten von nun an diesen kargen Ort wie der Virus seinen Körper.
Jarmans Garten war Ausdruck einer Krise und zugleich Zustimmung. Er wusste, dass er gegen den Befall seines Körpers nichts mehr ausrichten konnte. Er legte einen Ort an, um seinem neuen, noch fremden Partner in sich selbst einen Raum zu geben. Er war der Wirt für den Virus, der Garten wiederum ließ Jarman Zeit, die er nicht mehr hatte, um zu trauern: „I live on borrowed time (…) The gardener digs in another time, without past or future, beginning or end“, schrieb er in sein Tagebuch. Er musste seine Zeit von nun an anders angehen, betrachten, verschwenden. Diese geliehene Zeit, die gleichzeitig eine geschenkte war, ließ Jarman 1990 einen zweiten Garten anlegen. Er lieh sich eine neue Zeit, die mit allem Vorgehenden brach. Es gab ein Leben vor dem Wissen um das Positivsein und eins danach. Er lieh sich, mit dem letzten was er hatte – die verbleibende und kontinuierlich schwindende Kraft, seine Hände, sein Augenlicht, seine Freunde – ein Geschenk, das ihn Zauberer und Entdecker zugleich sein ließ: Sprießen ließ er seinen verwunschen wirkenden Garten. Objekte und Pflanzen trafen sich, verbanden sich und bildeten neue Symbiosen. Bewohner wie Hasen und Motten überrumpelten ihn, er schenkte sich mit seiner verbleibenden Zeit Überraschungen, er schenkte sich auch einen zweiten Garten: The Garden, ein Film, den er 1990 drehte. The Garden ist eine exzessive Meditation über das Teilen und die Zerstörung, den Verlust und die Wut, den Moment und die Auflösung. Eine trauernde Landschaft von Bildern. Körper werden ausgepeitscht, aufgehangen, gesteinigt und von Kameras verfolgt. Absurde, fieberhafte Traumsequenzen springen zwischen Lust und Gewalt hin und her. Und wir sehen ihn, Derek Jarman selbst, wie er gärtnert. Bilder von Pilzen, Steinen, Schmetterlingen, Schnecken, Vögeln, Wolken und Mohn.
Den Ausbruch der AIDS-Epidemie reflektierte Jarman in seinen Tagebüchern, wo er über die zu frühen Tode seiner Freunde und den eigenen körperlichen Zerfall schrieb. Am 13. April nimmt er ein Telefonat zwischen ihm und seinem Freund Howard Brookner auf. Zu dem Zeitpunkt hatte Brookner sein Sprachvermögen schon verloren und fast 20 Minuten lang, so schreibt Jarman, kommunizierte sein Freund mit ihm durch ein „tiefes verwundetes Stöhnen“ („low wounded moaning“).
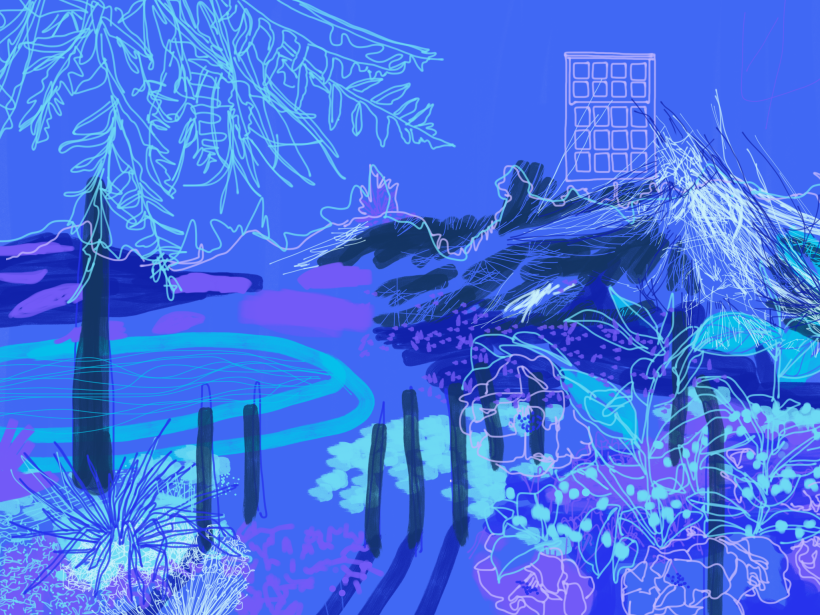
Der Film The Garden, eine Serie von Halluzinationen, wird durch Jarmans Tagebucheinträge, die eingesprochen wurden, unterlegt. Er endet mit dem Erzähler, der nur noch trauernd festhalten kann:
„I walk in this garden holding the hands of dead friends.
Old age came quickly for my frosted generation,
cold, cold, cold, they died so silently.
Did the forgotten generations scream or go full of resignation,
quietly protesting innocence?
I have no words, my shaking hand cannot express my fury.
Cold, cold, cold, they died so silently.“
Wenn es hier darum geht, AIDS mit dieser aktuellen Epidemie in Beziehung zu setzen, geht es, trotz oder vielleicht sogar wegen der Unterschiede, um Verhältnisse; um Verhältnisse zwischen dem Sichtbaren und Unsichtbaren, zwischen Vergangenem und Kommenden, und darum, „dass mein Leben ins Verhältnis zu dem Leben einer anderen Person gesetzt werden muss“, wie Carolin Emcke in ihren Journalen schreibt. Ich kann mir in den ersten Tagen meiner selbstgewählten Isolation nicht helfen, als in den Geschichten von an AIDS gestorbenen Künstlern zu graben, und zu versuchen, einen schiefen Kreis zur Gegenwart zu ziehen. Kurzschluss, warnt mich mein Gehirn: Wie und warum willst du AIDS mit Covid-19 in Verbindung bringen? Ich starre gegen meine weiße Wand, und es beruhigt mich, was auch sonst tun? „I can look at one plant for an hour, this brings me great peace“, notiert Jarman in seinem Tagebuch. Ich lese über all die verlorenen Freunde, Liebhaber, Brüder, Väter jener Zeit und frage mich:
Wer verliert jetzt seine ganzen Freunde, Liebhaber, Mütter, Großeltern? Wieso ist alles so ruhig?
Verhüllte Räume, eine Architektur der Unsichtbarkeit, in der all diese Menschen jetzt sterben und so viele, die an AIDS gestorben sind, kämpften dafür, in Sichtbarkeit zu sterben. Ich erinnere mich an die Gespräche mit meinen Freunden: die Panik nach jedem Sex, sich infiziert und sein Todesurteil unterschrieben zu haben, es aber trotzdem nicht sein lassen zu können. Und ich denke an die vielen ausgelebten und unterdrückten Wutausbrüche, die Menschen im Supermarkt jetzt befallen, wenn man ihnen zu nahe kommt, und gleichzeitig raven die Jugendlichen im Park zu holländischem Stampf-Techno, laufen weg, wenn die Polizei kommt und husten sich feixend an; die an Einsamkeit schon längst gewöhnten Senioren, von ihren überforderten Kindern in Altersheime gesteckt, führen sich noch genüsslich ihren Bienenstich zu Gemüte bevor die Polizei sie bittet, nun doch endlich die Bäckerei zu verlassen. Lebensmüde denke ich mir; was soll mich umbringen, was ich nicht sehe, denken die sich, sicherlich.
Wissen und Handeln, Vergangenheit und Gegenwart, Übertreibung und Paranoia, krank und gesund, krank oder gesund, Isolation oder Gastfreundschaft, Risiko oder Kondom, mit offenem Mund atmen oder durch die Nase, egal oder nicht egal, egal, dass ich vielleicht mal ein vergangener Gesunder war, jetzt bin ich potentiell krank, immer potentiell positiv, mein Sex immer schon krank und jetzt auch noch das Atmen, jetzt der ganze Körper potentiell ein krankes Risiko, vielleicht bin ich sogar schon krank und eine Virenschleuder, schuldig oder unschuldig, krank oder tot, alles eine Frage meiner gefühlten Zeit, von der ich jetzt so viel habe, die mir geschenkt wurde wie ein hässlicher Pullover.
AIDS begann in den frühen 1980er Jahren mit Toten. Zuerst herrschte Verwirrung und Unverständnis. Schnell waren die Körper befallen: mit nächtlichem Schweiß, Gürtelrose, Durchfall, Entzündungen im Mund, die es den Betroffenen verunmöglichten zu essen, einer extrem selten auftauchenden Form von Lungenentzündung. Männer in ihren 20ern, die plötzlich an Demenz erkrankten, schrumpfende, sich auflösende Gehirne. Anfangs herrschte bloß das Sterben und niemand wusste, „um was für eine Krankheit es sich handelt“, schreibt Martin Reichert in Die Kapsel. AIDS in der Bundesrepublik. David France erinnert sich in seinem 2012 veröffentlichten Buch How to Survive a Plague: „Sexy Tommy McCarthy from the classifieds department stayed out late at an Yma Sumac concert. Friday he had a fever. Sunday he was hospitalised. Wednesday he was dead.“ Dann kamen die ersten Tests auf den Markt.
Ein Virus, nachweisbar im Blut.
Man konnte bereits erkrankt sein, es aber nicht wissen, noch nicht wissen, aber erwarten, „a new class of lifetime pariahs“ und „the future ill“ schreibt Susan Sontag in Aids and its Metaphors. Und Derek Jarman notiert, kurz nach seiner Diagnose, in seinem Tagebuch: „I thought: this is not true, then I realised the enormity. I had been pushed into yet another corner, this time for keeps ... The perception that knowing you’re dying makes you feel more alive is an error. I’m less alive. There’s less life to lead. I can’t give 100 per cent attention to anything – part of me is thinking about my health.“
Es kommen erste Witze auf, „Aidskranke denken immer positiv“, „What does gay stand for? – Got Aids Yet?“
Infiziert zu sein bedeutete in diesen Zeiten nicht nur, das eigene Sterben zu verfolgen, sondern vor allem auch das seiner Freunde, Bekannten, Geliebten. Jarmans Tagebuch, April 1989: „Since autumn: Terry, Robert, David, Ken, Paul, Howard. All the brightest and best trampled to death – surely even the Great War brought no more loss into one life in just 12 months, and all this as we made love not war.“
Für den spanischen Künstler Pepe Espaliú ging es in seinen letzten Jahren nur noch darum, den Glauben an die anderen nicht zu verlieren, sich von seinen Mitmenschen tragen zu lassen, um das Virus zu überleben. Isolation war keine Option mehr. Begleitend zu seiner Skulpturenserie Carrying – vertikal an Wände installierte, von Stahlriemen durchlöcherte und getragene schwarze Skulpturen, die Ähnlichkeit mit den schwarzen Sänften haben, um die im 18. Jahrhundert an der Pest gestorbenen Menschen in Venedig abzutransportieren – entwickelte er eine gleichnamige Aktion. Der abgemagerte und barfüßige Künstler ließ sich über kurze Distanzen hinweg von zwei Menschen durch die Straßen Spaniens tragen, die ihn wiederum an ein anderes Paar weitergaben. Der Träger des Virus wurde zum Getragenen – militant und wütend machte er eben nicht alleine auf die Situation von AIDS in Spanien aufmerksam, sondern band alle ein, die tragen wollten und konnten.
Erst mit der Gründung von selbstorganisierten Vereinen und Interessensverbänden wie ACT UP (AIDS Coalition to Unleash Power) im Jahr 1987 in den USA oder der Deutschen AIDS-Hilfe im Jahr 1983 haben sich Betroffene und ihre Angehörigen mit medienwirksamen Protestaktionen gegen die Stigmatisierung, gegen den Status Quo, für mehr Solidarität und aktiven wissenschaftlichen Fortschritt zur Bekämpfung der Krankheit eingesetzt. Das Bemühen einer relativ kleinen Anzahl von Menschen war die Quelle sozialer Transformationen, die bewirkten, dass HIV-positive und an AIDS erkrankte Menschen anerkannt und respektiert wurden, dass sie überhaupt medizinische Hilfe erfahren haben.
*
Heute wie damals wurde dieser Virus mit allen vorangehenden Epidemien verglichen, die Pest, Lepra, Typhus, Cholera, Krankheiten als sozialer Text, wie Susan Sontag schreibt, um das Böse, Aussätzige, Randständige mit der Krankheit zu verweben, und wir erinnern uns: Text kommt vom Lateinischen texere, ‚weben‘, ‚flechten‘, und die Krankheit wird in die Welt geflochten, Verschwörungstheorien waren auch nicht weit: HIV als US-amerikanische Biowaffe, die 1977 in Fort Detrick entwickelt wurde, HIV als harmlose Grippe und erst die antiretroviralen Medikamente würden überhaupt AIDS auslösen. Millionen von Menschen siechten dahin, erst konnte, dann wollte ihnen nicht geholfen werden, Staaten ließen ihre Bürger an der von Gott geschickten oder der von Wissenschaftlern entwickelten Krankheit verenden, je nach Standpunkt.
Es gibt vieles, was möglich ist in dieser Welt, aber auch vieles, was einfach unglaublich ist. Unglaublich und etwas witzig, dass Menschen in Großbritannien 5G-Funkmaste verbrennen, weil sie glauben, dass 5G das Coronavirus verbreite. Unglaublich und traurig, wenn klare Beweise vorliegen, dass durch die Einnahme von Medikamenten der Ausbruch von AIDS verhindert werden kann, sich Menschen aber davor wehren, weil sie glauben, mit diesen Medikamenten würde ihnen AIDS überhaupt erst eingepflanzt. Eine Gesellschaft der Suchenden sind diejenigen, die sich diesen Theorien hingeben, und sie suchen weiter, selbst wenn sich eine Wahrheit vor ihnen offenbart. Es gibt auch AIDS-Verschwörungstheorien, die von Betroffenen verbreitet werden: Gegentheorien, um das Stigma zu legitimieren, „symbolische Erwiderungen der Sündenböcke“, schreibt der Medizinanthropologe Paul Farmer. So wie mit allen vorangegangen Epidemien der Menschheitsgeschichte auch wurde AIDS moralisch gelesen, mit Bedeutung aufgeladen: AIDS als Strafe für alles Verdorbene dieser Welt, AIDS als Exempel, AIDS als Metapher, natürlich.
Eine Freundin schreibt mir, dass manche, die bei Corona zwar nicht an eine wohlverdiente Strafe Gottes glauben, sich aber gerade deshalb in Verschwörungstheorien verlieren. Weil doch jemand die Verantwortung tragen muss, die Schuld, einen Plan haben muss – und das, schreibt sie mir, sei das große Missverständnis von 2000 Jahren abendländischer Erziehung.
Wer ist jetzt verantwortlich, wenn wir alle den Virus tragen können und potentiell zukünftige Kranke sind?
Daran denke ich, wenn ich, und es scheint eine Ewigkeit her, an die Zeit denke, als die ersten Fälle in China an die Öffentlichkeit kamen, in Singapur, in Vietnam. Der soziale Text dieses Virus wurde sofort rassistisch gelesen, als das Wort „China“ in das globale Lexikon des COVID-19 Diskurses eintrat. Die Paranoia produzierte Hass und Rassismus in Wort, Bild und Tat: In London wurde der aus Singapur stammende Student Jonathan Mok auf offener Straße verprügelt, „I don't want your coronavirus in my country“, dem Kurator An Nguyen aus Vietnam wurde die Teilnahme an der Affordable Art Fair verweigert mit der Begründung, dass Asiaten „Träger des Virus“ („carriers of the virus“) seien, das „China-Virus“, „Kung-flu“, „Wuhan-Virus“, Spiegel-Cover 6/2020: „Made in China“, der Fußballverein RB Leipzig verbot 20 japanischen Fans den Eintritt zum Spiel gegen Bayer Leverkusen, in Nürnberg wurden rohe Eier gegen die Häuser japanischer Besitzer geworfen. Wir erinnern uns an Susan Sontag: Jede Krankheit, deren Ursache noch ungeklärt ist, für die noch keine Behandlung entwickelt wurde, wird mit Bedeutung geflutet, der Krieg der Bezeichnung beginnt. Lang schon vorherrschende Ängste und Paranoia verbinden sich mit der Krankheit, und sie wird zur Metapher. Dann, im Namen der Krankheit, werden diese Ängste auf Anderes, in den meisten Fällen, Andere, andere Menschen, übertragen. Die Krankheit wird als Adjektiv verwendet, im Französischen wird, so erinnert uns Sontag, eine bröckelige Steinfassade immer noch als „lépreuse“ bezeichnet, AIDS als der „schwule Krebs“.
*
Eigentlich würde ich mich jetzt in meiner dritten Probenwoche für die Adaption von Oscar Wildes Das Bildnis des Dorian Gray befinden, aber selbstverständlich sind auch Theaterproben abgesagt worden. Alle Materialien, Ideen, Vorhaben sind suspendiert, vorerst, es ist wie Sex ohne Orgasmus. Auf den Spuren von Oscar Wildes letzten Lebensjahren bin ich nach Paris gefahren. Sein Grab liegt auf dem Friedhof Père Lachaise. Ein glatter, moderner Grabstein – entworfen vom britischen Bildhauer Jacop Epstein, in Auftrag gegeben von Wildes Liebhaber Robert Ross. Sein Grab ist eines der am häufigsten besuchten Orte. Wildes Grabstein ist über und über mit Lippenstiftabdrücken überzogen – „the madness of kissing“, schrieb Wilde, für nichts anderes waren die „red-roseleaf lips“ seines Liebhabers Lord Alfred Douglas da – und, wie so viele Dinge, die wir Menschen gerne tun, erscheint in diesen Tagen auch das Küssen wie aus einer anderen Zeit. Nach zwei Jahren Haft im Zuchthaus floh der irische Schriftsteller nach Paris. 1895 wurde Wilde wegen Sex mit Männern zu Zwangsarbeit verurteilt. Über Nacht wurde einer der gefeiertsten englischsprachigen Schriftsteller zum verurteilten Sexualverbecher. Er starb, verarmt und unter dem Pseudonym Sebastian Melmoth lebend im Alter von 46 Jahren am 30. November 1900 in einem schäbigen Pariser Hotel an einer Hirnhautentzündung. Sein Grabstein ist mit einer Strophe aus seinem Gedicht The Ballad of Reading Gaol verziert (anonym veröffentlicht unter dem Pseudonym C3.3, Wildes Gefängnisidentität: Block C, Trakt 3, Zelle 3):
„And alien tears will fill for him
Pity’s long broken urn,
For his mourners will be outcast men,
And outcasts always mourn.“
„Des Mitleids gesprungene Urne sind
Fremde Tränen zu füllen bereit,
denn die ihn betrauern – Geächtete sind’s,
und Geächtete trauern allzeit.“
Später war ich im Centre Pompidou. Ich erinnere mich nicht mehr, auf welcher Etage ich mich befand, als ich in einer Ecke auf die Arbeit Untitled (Portrait of Ross in L.A.) von Félix González-Torres stieß, ein kubanisch-amerikanischer Künstler. Als ich mich der Installation näherte, musste ich lachen. Ein bunter Haufen Bonbons, eingewickelt in verschiedenfarbiges Zellophan, lag in der Ecke. Als ich dann schließlich vor der Arbeit stand, las ich: Alle Bonbons zusammen haben das Gewicht des Partners von Félix González-Torres, als er an AIDS zu sterben begann. Ich las weiter: Man solle sich als Besucher ein Bonbon nehmen, irgendwann wird jedes entwendete Bonbon mit einem neuen ersetzt. Seit 1991 wird dieser Haufen regelmäßig aufgefüllt. Das Jahr, in dem ich geboren wurde. Ich lutschte einen Bonbon, das außer seinem Zucker keinen erkennbaren Geschmack hatte. Ich hatte nie die Geduld für Bonbons und zerbiss es rasch. Ein Gramm weniger von Ross. Wann nur, fragte ich mich, wird dieses Gramm wieder aufgefüllt? Félix González-Torres starb ebenfalls an AIDS.
*
Das Pharmazieunternehmen Gilead aus den USA führt weltweit die Entwicklung eines Impfstoffes gegen Corona an. Gilead ist dasselbe Unternehmen, das bis zum Ende dieses Jahres das Patent auf Truvada besitzt, heute besser bekannt als PrEP, ein präventives HIV-Medikament, das durch regelmäßige Einnahme vor einer Infektion mit HIV schützt. Genau dieses Patent war es, für das die Aktivisten von ACT UP gekämpft haben, um eine weitreichende, für alle zugängliche Behandlung zu gewährleisten. Gileads Studien, die zur Zulassung von PrEP geführt haben, wurden fast ausschließlich von öffentlichen Institutionen und privaten Geldgebern finanziert. Das Unternehmen, das ein Medikament herstellt, welches flächendeckend die Ansteckung mit HIV verhindert, hat den Großteil seiner Forschung an Truvada aus privaten Spenden (höchstwahrscheinlich von reichen Witwern, die ihre Partner an AIDS verloren haben) und öffentlichen Fördermitteln erhalten. Gilead fordert für eine monatliche Behandlung mit PrEP fast 1500 Dollar. ACT UP hat berechnet, dass die Produktionskosten für eine Monatsration bei 6 Dollar liegen. Das sind zwar US-amerikanische Zustände und muss uns hier nicht sonderlich beunruhigen, denn: Seit September 2019 werden die Kosten für PrEP in Deutschland von den Krankenkassen übernommen.
Wenn aber dieser soziale Text, in dem wir alle, ausnahmslos alle, eingeflochten sind, meine Gedanken zwischen HIV und Corona hin und her springen lässt und ich Elemente sehe, die wie in einer Zentrifuge umeinander tosen – Stigma, Solidarität, Versöhnung, Ausbeutung –, wenn ich beobachte, dass von Staaten subventionierte Unternehmen ihre Produkte wiederum, in einem zweiten Schritt, ausschließlich durch erneute staatliche Subventionen zu bezahlbaren Preisen oder gar kostenlos anbieten, dann muss ich doch gleichzeitig auch sehen und befürchten, dass genau dieselben Aktionärsbefriedigungen stattfinden werden, sobald ein Impfstoff gegen Corona auf dem Markt ist, dass wieder alle Staaten, die es sich leisten können, diese Unternehmen mit Geld fluten werden, dass wieder Jahre oder Jahrzehnte vergehen werden, bis das Patent ausläuft und ein bezahlbares Generikum für den Rest der Welt verfügbar ist und wer bis dahin nicht verreckt ist, kann bis zu 20 mal so viel wie in normalen Zeiten für eine Maske oder Desinfektionsmittel bezahlen und die Falschheit dieser Situation liegt wie eine offene Wunde unumstößlich vor uns und darum geht es:
Sich in Beziehung zu setzen, zu erkennen, dass die tragischen Konsequenzen, die eine nicht existierende universelle Krankenversicherung und Medikamente für alle Menschen dieser Welt, sollte es nächstes Jahr einen Impfstoff gegen den Coronavirus geben, zu genau solchen Kämpfen führen werden, wie sie politische Bewegungen wie ACT UP seit über 30 Jahren führen.
*
Ich schaue mir in diesen Tagen wieder die Serie Pose an. Ihre Protagonisten leben im New York der späten 1980er Jahre, mitten in der AIDS-Krise. Sie sind schwarz, trans, schwul, Latinas, von Zuhause Weggerannte und Verstoßene. Ihr neues Zuhause sind die „Houses“, in denen sie sich unter die Obhut einer „Mother“ versammeln, sich einen Ort schaffen in einer Welt, die sie nicht will, sie tanzen, treten in „Balls“ gegeneinander an und träumen, jemand zu sein, der sie in den meisten Fällen nie sein werden. Eine Gemeinschaft von Überlebenden, in der sich der Virus ausbreitet wie ein Flächenbrand. Blanca ist positiv, Pray Tell ist positiv, Ricky ist positiv. Eine Gemeinschaft von Positiven, die sich gegenseitig Mütter sind, als der Staat versagte.
Ich glaube, weshalb sich meine Gedanken in diesen Zeiten um die AIDS-Epidemie entzünden, liegt möglicherweise darin, dass ich mich gerade, Glück des Nachgeborenen, mit diesem Krieg gegen Körper retroperspektiv auseinandersetze. Inmitten dieser Rekonstruktion einer Geschichte, die auch hätte meine sein können, wird diese Geschichte auch meine, indem ich nach Verhältnissen suche, sie aufstelle wie ungerade Gleichungen. Und jetzt befinde ich mich mittendrin, keine Distanz möglich, noch nicht. Ich stelle das vage Gefühl einer Gemeinschaft her, die ich nicht mehr sehen kann, weil sie nicht mehr da ist, und die ich einfach gerade jetzt akut nicht sehen kann. Wie kommen wir zusammen, wenn wir uns nicht berühren können? Ähnlich egal wie meinen Freunden, die sagen, mit HIV zu leben ist mittlerweile ein besseres Los als an Diabetes erkrankt zu sein, war mir Corona anfangs auch:
Es wird mich nicht treffen, selbst wenn es mich trifft. Wenn aber jetzt jeder positiv werden kann, welche Übungen in historischer Empathie lassen sich denken, da jeder von uns zum Infizierten, positiv werden kann, der durch den einen Besuch zu viel seine Großeltern ins Grab bringt?
Können wir jetzt nachvollziehen, warum so viele als exaltiert, überzogen, theatral, affektiert, kitschig, eben als „camp“, bezeichnete Arten und Weisen des Seins eine Reaktion auf eine kranke Welt waren, die behauptet normal zu sein? Verstehen wir jetzt die Paranoia derjenigen, die bei jedem Schnupfen und Kratzer im Hals das Desaster haben kommen sehen, die jedes negative Testergebnis nur als aufgeschobenes Urteil wahrnahmen? Die Trauer, sich nicht mehr verabschieden zu können, weil der Zugang zum Krankenhaus verwehrt wurde?
Die anfängliche Untätigkeit, ja das blanke Ignorieren derjenigen Staaten, es werde einen schon nicht treffen, „der schwule Krebs“ ist eben eine Sache der Schwulen, und Covid-19 eine „Kung-flu“? Das unsichtbare Leiden, Freunde sterben, aber die Krankheit, der Tod, alles wird verborgen. Die Kraft, die einen zum Betroffenen und Getroffenen macht, sie ist jetzt keine mehr, die sich um Sexualität kümmert.
*
Die britische Schriftstellerin Daisy Hildyard schreibt: „Every living thing has two bodies.“ Der eine Körper kann trinken, essen und schlafen. Der zweite ist in einem weltweiten Netzwerk von Beziehungen eingebunden. Dieses Netzwerk ist nicht der immer etwas abstrakt anmutende Hinweis darauf, dass wir mit jedem Produkt, das wir tragen, konsumieren und verwenden, mit dem Schweiß und Blut fremder Körper verbunden sind. Dieses Netzwerk ist eines, dass diesen meinen Körper mit all den Körpern verbindet, die es mal gab, Kämpfe, die geführt wurden, können, schneller als ich zum Arzt rennen kann, auch zu meinen Kämpfen werden – eine Verbindung, die da ist, ich muss nur hingucken, oder besser: zuhören. Wann zuhören, wenn nicht jetzt, in diese scheinbare Leere, in die Abwesenheit einer jeden Berührung, einer jeden Versammlung. Das Netzwerk trennt Vergangenheit und Gegenwart nicht voneinander, sondern ist ein Ineinander der Epochen. Das Netzwerk ergreift jeden, sein Spinnennetz webt sich von innen nach außen, es öffnet die Tore des Archivs und aus dem tönt es: Blau spricht es zu mir, ich starre weiterhin an die Wand, aber Blue, der letzte Film, den Derek Jarman kurz vor seinem Tod fertig stellen konnte, spricht – die Farbe spricht: Wir sehen einfach nur den Ausschnitt einer ultramarinblauen Farbfläche. Stimmen sprechen, sie sprechen von endlosen Nebenwirkungen, die die endlosen Medikamente hervorrufen, sie erzählen von Orgien, Freiheiten, von der Hoffnungslosigkeit. Wir hören einer verlorenen Welt zu, die immer noch zu unserer gehört. Jarman zeigt keine ausgezehrten, einsamen Körper, sein letzter Film ist ein Garten des Zuhörens, „stop looking at us: start listening to us“ hallt es aus den Archiven, sie sagen: hören wir dem Virus zu, wie er unsere labile Gemeinschaften trifft und verändert, wiederholen wir nicht dieselben Fehler, in die uns die Paranoia schon einmal geführt hat:
„O Blue come forth
O Blue arise
O Blue ascend
O Blue come in“
*
Mazlum Nergiz, *1991, ist Dramaturg, Autor und Hörspielmacher. 2019 hat er den EDIT Essaypreis gewonnen. Im August 2020 kommt das Hörspiel zu Sivan Ben Yishais Stück Papa liebt dich zur Ursendung im Deutschlandradio Kultur. Seit 2019 ist er Dramaturg am Schauspiel Hannover.
